| Startseite | Impressum | Suchen | Rubrik: Bücher und Rezensionen | siehe auch: Schriften zum Programm | 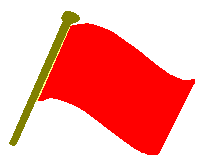 |
Zeitschriftenrezension von Dieter Elken:
Marxistische Blätter Nr. 3/2004
"Das Problem der Übergänge"
Unter diesem Titel leiten die Marxistischen Blätter Nr. 3/04 den Schwerpunkt des Heftes ein, eine Debatte "Zur Problematik der Übergangsforderungen in der Strategie der sozialistisch-kommunistischen Bewegung. Geschichtliches und Aktuelles". Die dokumentierte Debatte fand im Januar in Leverkusen statt. Es handelte sich wohl um die erste Debatte in Deutschland, an der u.a. Stalinisten, Brandlerianer und Trotzkisten teilnahmen. Teilnehmer mit im Heft dokumentierten Beiträgen waren Hans-Joachim Krusch vom Marxistischen Arbeitskreis zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung bei der PDS, Christoph Jünke (Redaktion Sozialistische Zeitung), Manuel Kellner und Angela Klein von der Internationalen Sozialistischen Liga (ISL), Günter Judick, Willi Gerns, Robert Steigerwald, Hans-Peter Brenner, Horst Schneider (alle DKP), Hartwig Otto und Herbert Münchow (Redaktion Arbeiterpolitik).
Das Referat des bald nach der Veranstaltung verstorbenen Hans-Joachim Krusch: "Arbeiterregierung" als Übergangsforderung der KI, führte in hochinteressanter Weise in das Thema ein. Diesen Beitrag zu lesen lohnt bereits allein wegen seiner sehr informativen Darstellung zum Thema Arbeiterregierung. Dasselbe gilt auch für den Beitrag Hartwig Ottos und Herbert Münchows "Übergangslosungen und der Charakter eines Aktionsprogramms der KPD" bezüglich der Auseinandersetzungen in der KPD der zwanziger Jahre.
Übergangskonzeption und Einheitsfrontpolitik
Das Wesen der mit der Konzeption der Übergangsforderungen auf das Engste verbundenen und von ihr nicht zu trennenden Einheitsfrontpolitik wurde von Krusch allerdings nur sehr unzureichend beschrieben. Deren Wesen bestand nicht nur darin, die "Aktionseinheit der Arbeiterparteien" und das "Zusammengehen der Arbeiter ohne Unterschied ihrer Organisationszugehörigkeit und weltanschaulichen Bindungen herbeizuführen", sondern zugleich darin, Bedingungen zu schaffen, die es der revolutionären, kommunistischen Partei erlauben sollten, die Mehrheit der Arbeiterklasse für weitergehende Ziele und schließlich die sozialistische Perspektive zu gewinnen.
Einheitsfront in diesem Sinne - und im Sinne des 3. und 4. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale, hieß Einheitsfront von oben und unten, d.h. in erster Linie Kampf für Aktionsbündnisse zwischen den großen Arbeiterparteien unter Einbeziehung der von ihnen organisierten und beeinflußten Massenbasis. Es galt dabei, jeweils solche konkreten Ziele durchzusetzen, die objektiv und subjektiv im Interesse der Arbeiterklasse lagen. Die Linke Opposition der KPD forderte zu diesem Zweck Verhandlungen der Führungen von KPD und SPD, um ein Kampfabkommen zur Verhinderung des faschistischen Sieges abzuschließen und umzusetzen. Die Verfechter dieser Art von Einheitsfrontpolitik fochten in den zwanziger Jahren und zu Beginn der dreißiger Jahre vergeblich dafür, in der KPD diese Politik gegen die ultrasektiererische Linie Stalins und Thälmanns mit ihrer Politik der Einheitsfront nur von unten durchzusetzen. Die Durchsetzung der Linie Stalins bedeutete das völlige Versagen der KPD-Führung und Stalins im Kampf zur Verhinderung des Aufstiegs der faschistischen Bewegung und der letztendlichen nationalsozialistischen "Machtergreifung".
Unabhängigkeit von der Frage nach der Richtigkeit der Einschätzung Kruschs, daß 1923 in Deutschland keine akut vorrevolutionäre Lage bestand, beschreibt Krusch im Ergebnis richtig, daß sich sowohl die KPD wie die Kommunistische Internationale nach dem Tode Lenins vom Konzept der Übergangsforderungen ebenso verabschiedeten, wie von der Einheitsfrontpolitik. Krusch warnt dann mit Recht davor, aus der Debatte der zwanziger Jahre kurzschlüssige Folgerungen für die Gegenwart zu ziehen. Ihm scheint aber dabei nicht klar zu sein, daß das Konzept der Übergangsforderungen nicht so sehr an konjunkturelle Gegebenheiten anknüpft, sondern auf dem Verständnis der imperialistischen Epoche als der Epoche des niedergehenden Kapitalismus beruht.
Ausgangspunkt ist somit die grundlegende Notwendigkeit und objektive historische Möglichkeit der sozialen Revolution. Zugleich beruht die Konzeption der Übergangsforderungen aber auf der Einschätzung, daß zumindest die Mehrheit der Arbeiterklasse erst noch für den Kampf um den Sozialismus gewonnen werden muß. Hieraus ergibt sich die Hauptaufgabe einer jeden kommunistischen, revolutionären Partei: der Arbeiterklasse dabei zu helfen, sich ihrer gesellschaftlichen Stellung und ihrer Möglichkeiten bewußt zu werden, sich ihrer Kraft zu vergegenwärtigen und damit ihr Bewußtsein auf die Höhe der ihr objektiv gestellten historischen Aufgaben zu entwickeln.
Wer die Welt verändern will, muß sie kennen
Die von Krusch geforderten, vom Wunschdenken befreiten Analysen der globalen Veränderungen im kapitalistischen System, des Kräfteverhältnisses zwischen den Klassen und der Strukturveränderungen in der Arbeiterklasse, ihrer Lage und ihres ideologischen Zustandes müssen allerdings in zumindest in groben Umrissen vorhanden sein, um sich die Realisierung der Aufgaben der Kommunisten nähern zu können. Klar ist am Ende seines Referats, daß Krusch trotz seiner Überzeugung, daß die Orientierung auf Übergangsforderungen ein Zentralelement jedes Programms sein muß, das die Trennung zwischen Minimal- und Maximalprogramm überwindet, über keine dieser von ihm geforderten aktuellen Analysen verfügte.
Die Volksfrontlegende wird weiter gepflegt
Dies brachte ihn dazu, die Lösung der von ihm aufgeworfenen Probleme in einem Rahmen zu suchen, der mit seinen teilweise schon gewonnenen Erkenntnissen über den von Stalin vollzogenen Bruch mit der Kominternpolitik Lenins nicht vereinbar ist.
Hier rächt sich die doch oberflächliche und damit zugleich falsche Einschätzung der Auseinandersetzungen über die Einheitsfrontpolitik.
Krusch sieht offenbar die Volksfrontpolitik in der Tradition dieser Politik, weil sie sich offiziell auch zur Aktionseinheit der Arbeiterparteien bekennt. Er übersieht, daß jede bisherige Variante der Volksfrontpolitik nicht nur die Einheitsfront der Arbeiterparteien von oben realisieren, sondern dazu auch Teile der Bourgeoisie einbeziehen will. Letzteres ist nur möglich, wenn die Arbeiterklasse auf den Kampf für die eigenen Klasseninteressen verzichtet. Dementsprechend hat noch jede Volksfront alles getan, Massenmobilisierungen zu bremsen und zugunsten der scheinbaren Breite des Bündnisses abzuwürgen. Auch diese Politik hat mit der Leninschen Politik der Einheitsfrontpolitik nichts zu tun. Sie ersetzt die Aktionseinheit der Arbeiterklasse durch Spitzenabkommen gegenrevolutionärer Reformparteien unter Beteiligung von Kommunistischen Parteien, die sich ihren Bündnispartnern in der Praxis unterordnen - und damit praktisch auf revolutionäre Politik verzichten.
Wenn Krusch propagiert, an den Erfahrungen Kommunistischer Parteien nach 1945 anzuknüpfen und dabei allem Anschein nach von der Existenz eines längerfristig stabilen "staatsmonopolistischen Kapitalismus" ausgeht, spricht das nur dafür, daß er sich noch auf dem Boden traditioneller stalinistischer Analysen bewegt. Es ist aber Wunschdenken zu glauben, es sei möglich, mit tiefgreifenden ökonomischen und politischen Strukturreformen die "Demokratie" entfalten zu können, um so "den Übergang zu einer antimonopolistischen Demokratie und letztlich zu einem anderen, einem sozialistischen Gesellschaftssystem" bewältigen zu können. Dies um so mehr, als die Masse der Arbeiterklasse bei dem damit verbundenen Konzept der Einheitsfront von oben keine eigenständige Rolle spielt. Deren Aufgaben werden von den Arbeiterparteien und ihren Apparaten übernommen, die sich an die Stelle der Arbeiterklasse setzen.
Das ist erstens Reformismus pur und natürlich ein Bruch mit Marx und den kommunistischen Traditionen der Zeit Lenins:
"Namentlich hat die (Pariser) Kommune den Beweis geliefert, daß die Arbeiterklasse nicht die fertige Staatsmaschine einfach in Besitz nehmen und sie für ihre eigenen Zwecke in Bewegung setzen kann." (Marx/Engels: Vorwort zur deutschen Ausgabe des Manifests der Kommunistischen Partei, 1872 in MEW 4,575).
In den Leitsätzen des 2. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale zum Parlamentarismus hieß es dementsprechend:
"Deshalb ist es die unmittelbare historische Aufgabe der Arbeiterklasse, diese Apparate den Händen der herrschenden Klasse zu entreißen, sie zu vernichten, und an ihre Stelle neue proletarische Machtorgane zu setzen. Gleichzeitig aber ist der revolutionäre Stab der Arbeiterklasse daran interessiert, seine Kundschafter in den parlamentarischen Einrichtungen der Bourgeoisie zu haben, um diese Aufgabe der Zerstörung zu erleichtern. Hieraus ergibt sich ganz klar der Grundunterschied zwischen der Taktik des Kommunisten, der mit revolutionären Zielen in das Parlament eintritt, und der Taktik des sozialistischen Parlamentariers. Der letztere geht von der relativen Festigkeit, der unbestimmten Dauer der bestehenden Herrschaft aus. Er macht es sich zur Aufgabe, mit allen Mitteln Reformen zu erreichen, und ist daran interessiert, daß jede Errungenschaft von der Masse in gebührender Weise als verdienst des sozialistischen Parlamentarismus geschätzt wird.
An die Stelle des alten Anpassungsparlamentarismus tritt der neue Parlamentarismus als eines der Werkzeuge zur Vernichtung des Parlamentarismus überhaupt."
Einschneidende Strukturreformen führen sofort zu Entscheidungskämpfen
Hinzugefügt sei zweitens, daß schrittweise durchgesetzte, tiefgreifende Strukturreformen zum wütendsten und nötigenfalls gewaltsamen Widerstand des Monopolkapitals führen müssen. Ohne soziale Revolution, ohne Entmachtung der Bourgeoisie und ohne die Schaffung eines Rätestaates muß die Arbeiterklasse scheitern. Eine zugespitzte revolutionäre Situation oder auch nur ein Zustand, indem sich die Bourgeoisie bedroht sieht, ein Zustand äußerster gesellschaftlicher Labilität, kann nicht lange andauern. Er wird in die eine oder andere Richtung aufgelöst. Das zeigten in der jüngeren Geschichte Chile und Nikaragua. Das belegen aber sogar die Entwicklungen in den Volksdemokratien nach 1945, in denen die Machtfrage bekanntlich keine ernsthafte Rolle spielte, weil die Macht von vornherein in den Händen der sowjetischen Besatzungsmacht lag. Beim Konzept der antimonopolistischen Demokratie stimmen deshalb weder Logik noch Analyse.
Erfolgreiche historische Beispiele für die damit verbundene Strategie lassen sich nicht benennen. Man mag marxistischen Revolutionären entgegenhalten, daß erfolgreiche soziale Revolutionen nur unter größten Schwierigkeiten zu realisieren sind. Aber sie beruhen wenigstens auf einem in sich schlüssigen Konzept und die russische Revolution bewies, daß eine revolutionäre Strategie erfolgreich sein kann.
Die Kominternstrategie beanspruchte nicht mehr und nicht weniger, als die Lehren der russischen Revolution international fruchtbar zu machen - ohne in irgendeinen Modellschematismus zu verfallen.
Die Einheitsfrontpolitik der Komintern zu Zeiten Lenins war das taktische Vehikel, die Arbeiterklasse trotz ihrer ideologischen Spaltung zu mobilisieren und im realen, außerparlamentarischen Kampf zu organisieren. Die klassenpolitische Grundlage für diese Mobilisierungen waren die für jede Etappe dieses Kampfes formulierten Übergangsforderungen, die die Ziele dieser Kämpfe formulierten.
Diese, anfangs nur von der revolutionären Partei systematisch propagierten Forderungen, können nur Mobilisierungskraft entfalten, wenn sie die Klasseninteressen und Kampfbedürfnisse des Proletariats und seiner Bündnispartner zum Ausdruck bringen. Insofern sie dies tun, sind diese Forderungen auch dann, wenn sie im Einzelfall abstrakt logisch im Kapitalismus realisiert werden könnten, unter den konkreten Bedingungen des Klassenkampfs jeweils mit den Klasseninteressen der Bourgeoisie unvereinbar. Selbst dann, wenn sich die Bourgeoisie gezwungen sieht, einzelne dieser Forderungen zuzugestehen, werden solche zeitweiligen Kompromisse von der herrschenden Klasse bei andauernder Krise baldmöglichst wieder in Frage gestellt. Hält die Arbeiterklasse an ihren Errungenschaften fest, hat der Kampf um das System von Übergangsforderungen die Tendenz, über sich hinauszutreiben und den Klassenkampf zu verallgemeinern.
Der antagonistische Charakter der Klasseninteressen von Proletariat und Bourgeoisie schließt folglich in kapitalistischen Krisenperioden solche Bündnisse zwischen diesen beiden Klassen aus, die den proletarischen Klassenkampf entwickeln oder im Interesse des Proletariats liegen.
Tatsächlich beweist ausnahmslos jedes historische Beispiel für derartige klassenübergreifenden Bündnisse von der Burgfriedenspolitik der Sozialdemokratie 1914 bis zu den Volksfronten , daß diese Allianzen nur um den Preis der Suspendierung des proletarischen Klassenkampfs und des Kampfs für den Sozialismus zustande kommen. Immer erwiesen sich die bürgerlichen Kräfte in solchen Bündnissen als viel konsequentere Vertreter der Bourgeoisie als die Arbeiterpolitiker der Sozialdemokratie und später der Stalinisten als reale Vertreter der Arbeiterklasse. Die Hauptkräfte der Bourgeoisie (mit Ausnahme der der Tschechoslowakei nach 1945) haben sich deshalb nicht einmal in schweren Krisen an Volksfrontbündnissen beteiligt. Um überhaupt den Anschein solcher klassenübergreifenden Volksfronten aufrechterhalten zu können, haben die Stalinisten immer wieder mit für die Bourgeoisie nicht repräsentativen bürgerlichen Individuen paktiert, zugunsten derartiger Schein-Klassenbündnisse den Kampf für proletarische Interessen eingestellt und sogar die unabhängigen revolutionären Kräfte mit Verve allein oder gemeinsam mit der Reaktion bekämpft.
Volksfrontpolitik bedeutete somit immer das Gegenteil von leninistischer Einheitsfrontpolitik und nicht die Rückkehr zu ihr. Diese letztere Behauptung, die u.a. den Referaten von Willi Gerns, Hermann Krüger, Hans Peter Brenner und Horst Schneider zugrunde liegt, ist stalinistische Geschichtsklitterei. Nichts zeigt das besser, als die Tatsache, daß die Materialien des 3. und 4. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale zur Einheitsfrontpolitik und zum Konzept der Übergangsforderungen vom Stalinismus jahrzehntelang tabuisiert waren und nie wieder aufgelegt wurden.
Keine Kontinuität in der Politik der Komintern
Günter Judick bedient die stalinistische Geschichtslegende mit einem rhetorischen Trick: Er legt in seinem Beitrag über den 7. Weltkongreß der Komintern und die Volksfronten in Frankreich und Spanien dar, inwiefern die Kommunistische Internationale mit den Thesen des 6. Weltkongresses brach. Er behauptet dann, der 7. Weltkongreß habe mit den Fehlern des 6. Weltkongresses aufgeräumt und dessen strategische Fehleinschätzungen korrigiert. Er suggeriert, damit sei die Rückkehr zur leninistischen Politik der ersten vier Weltkongresse der KI vollzogen worden.
Dies, obwohl er selbst feststellt, die Komintern 1935 habe jede Bezugnahme auf die Leninsche Einheitsfrontpolitik und die Übergangsforderungen vermieden. Dies erklärt er damit, die Kominternführung habe die Ursachen der Fehler des 6. Weltkongresses vertuschen wollen. Auf diese Weise erspart er sich die Mühe, seine These von der Kontinuität der Leninschen Politik zu der des 7. Weltkongresses der KI konkret nachzuweisen. Stattdessen tut er so, als seien die Einschätzungen des 7. Weltkongresses, besonders zum Faschismus, über jeden Zweifel erhaben. Von einem ernst zu nehmenden Nachweis dafür, daß die Politik des 7. Weltkongresses mit der der ersten vier Weltkongresse kompatibel ist, kann keine Rede sein. Aber auch die Analysen des 7. Weltkongresses waren strukturell falsch.
Bourgeoisie und Faschismus
Judick verkennt z.B., daß die von der Kominternführung unter Stalin erst 1935 (!) akzeptierte Erkenntnis, daß der (in Italien seit 1922) an der Macht befindliche Faschismus die Ablösung einer Staatsform der bürgerlichen, demokratischen Klassenherrschaft durch die offen terroristische Diktatur bedeutet, keineswegs den schematischen Schluß Dimitroffs und Stalins zuläßt, daß es festgefügte demokratische Kreise der Bourgeoisie einerseits und faschistische Kreise des Kapitals andererseits gibt. Die Bourgeoisie hat vielmehr grundsätzlich ein taktisches Verhältnis zu den konkreten Formen ihrer staatlichen Herrschaft. Sie bestimmt ihre Taktik nach der jeweiligen klassenpolitischen Lage im eigenen Land und berücksichtigt dabei natürlich auch die Internationalen Kräfteverhältnisse.
Sobald große Teile der Arbeiterklasse für ihre Interessen kämpfen. werden Teile der Bourgeoisie beginnen, mit faschistischen Bewegungen als Option zu spielen. Sobald die Bourgeoisie davon ausgeht, daß ihre Interessen im Rahmen bürgerlich-demokratischer Herrschaftsformen nicht mehr oder nur um den Preis dauerhafter und schwerer Nachteile durchgesetzt werden können, wird sich die Bourgeoisie von lästigen demokratischen Rücksichten befreien und zu offen terroristischen Herrschaftsmethoden greifen. Der Rückgriff auf den Faschismus mit seiner kleinbürgerlichen und lumpenproletarischen, zunächst unberechenbaren Massenbasis kommt für die Bourgeoisie nur in Frage, wenn sie um ihre Existenz bangt und andere Mittel nicht mehr ausreichen.
Niemals überlagern innerbürgerliche Interessengegensätze und Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Form bürgerlicher Herrschaft für nennenswerte Teile der Bourgeoisie den Interessengegensatz zum Proletariat.
Die Besonderheit der Volksfrontpolitik, das Bündnis der Arbeiterorganisationen mit den vorgeblich antifaschistischen Fraktionen der Bourgeoisie, beruht deshalb auf einer irrealen Fiktion. Mehr als Bündnisse mit für die Bourgeoisie nicht repräsentativen kleinbürgerlichen Demokraten, mit Schatten der Bourgeoisie, hat es regelmäßig nicht gegeben - auch nicht in den Volksdemokratien. Selbst in der Tschechoslowakei, in der die Bourgeoisie nach 1945 zunächst erfreut und dankbar die Hilfe der Stalinisten bei der Restauration eines nationalen tschechischen Kapitalismus begrüßte, brachen bald unüberbrückbare Konflikte aus (1947/48). Immer und überall aber haben die Stalinisten zugunsten ihrer virtuellen Klassenbündnisse mit der demokratisch-fortschrittlichen, antifaschistischen oder nach Bedarf als antimonopolistisch titulierten Teile der bürgerlichen Klasse den Klassenkampf des Proletariats gebremst und abgewürgt - bis hin zum Einsatz terroristischer und militärischer Mittel gegen revolutionäre Teile der Arbeiterklasse. Volksfrontpolitik ist immer und überall das Gegenteil der Leninschen Arbeitereinheitsfrontpolitik gewesen.
Volksfronten als Zwischenetappe
Robert Steigerwald, der die Kritik der von Brandler und Thalheimer geführten KP(O) an der KPD-Politik vor 1933 für richtig hält, gesteht den Trotzkisten sogar zu, daß deren Kritik an der Durchführung der nach dem 7. Weltkongreß der KI von deren Sektionen betriebene Politik berechtigt war. Er ist aber der Ansicht, die Kritik der Trotzkisten sei hinsichtlich des Wesens der KI-Politik unberechtigt. Der Gedanke, daß zwischen der Form dieser Politik und ihrem Wesen ein Zusammenhang bestehen könnte, scheint ihn nicht anzufechten.
Steigerwald behauptet, es gebe damals wie heute die Notwendigkeit von Zwischenetappen im Klassenkampf, im Gegensatz zur "trotzkistischen Vorstellung von einem möglichen unmittelbaren Übergang zum Sozialismus". Letzteres sei die Fortsetzung des ultralinken Kurses des 6. Weltkongresses der KI. Das mutet angesichts der fundierten und umfangreichen Kritik Trotzkis an den Einschätzungen und sektiererischen politischen Schlußfolgerungen des 6. Weltkongresses der KI schon leicht komisch an. Es fällt auch schwer zu glauben, daß Steigerwald die Kritiken Trotzkis an der ultralinken KPD-Politik bis 1934 nicht kennt. Dann seien ihm diese zur Lektüre empfohlen. Aber natürlich bekennen sich Trotzkisten schuldig, wenn es zu bekennen gilt, daß es zum Kapitalismus nur eine Alternative gibt, den Sozialismus. Hier gerät Steigerwalds Polemik gegen die Trotzkisten zur Polemik gegen Lenin.
Die Notwendigkeit einer historischen Zwischenetappe zwischen Kapitalismus und Sozialismus - wie sollte diese Etappe aussehen, welche Klassen sollen sie dominieren, welche Art von Produktionsverhältnissen wären in ihr vorherrschend, welche gesellschaftlichen Widersprüche würden ihre Entwicklung bestimmen? - stützt sich bei Steigerwald nicht einmal auf den Hauch einer plausiblen Analyse der jetzigen Lage des Imperialismus oder des Klassenkampfes. Mit dem Marxismus Lenins ist das ganze unvereinbar.
Steigerwald demonstriert mit seiner Etappenkonzeption, daß er die Dynamik von Klassenkämpfen nicht versteht. Mit der Einbeziehung neuer Schichten der Arbeiterklasse in die Kämpfe und ihrer Erweiterung werden regelmäßig neue Forderungen aufgestellt. Mit der Zuspitzung der Klassengegensätze vertieft das Proletariat seine Forderungen, radikalisiert und entwickelt sie aufgrund der in den Kämpfen gemachten Erfahrungen. Jede kämpfende Bewegung entwickelt sich über Zwischenschritte, Rückschläge, Sprünge, Bündnisse, einseitige Initiativen etc. In einer anhaltenden Krisenperiode - in der befinden wir uns - wird aber jeder Erfolg die Anstrengungen des Kapitals verstärken, verlorenes Terrain wiederzuerobern und der Arbeiterklasse alle Errungenschaften streitig zu machen. Für einen dauerhaften Klassenkompromiß gibt es daher keinen Raum. Die Arbeiterklasse wird nicht auf halbem Wege stehen bleiben können. Sobald sie in der Lage ist, die Macht des Monopolkapitals ernsthaft in Frage zu stellen, wird sie dessen Macht endgültig brechen müssen und einen Arbeiterstaat errichten. Alles andere würde in die Katastrophe führen.
Strategische Konfusion - und ihre materielle Grundlage
Auch im Referat von Willi Gerns kommt die ganze strategische Konfusion der DKP-Führung zum Ausdruck: Er schreibt, "die vereinigte Macht von Monopolkapital und kapitalistischem Staat" sei das entscheidende Hindernis auf dem Weg zum gesellschaftlichem Fortschritt, gegen das der Schlag gerichtet werden muß. Er zitiert dann die DKP-Thesen zum Düsseldorfer Parteitag von 1971: "Eine antimonopolistische Demokratie hat die grundlegende Veränderung des politischen Kräfteverhältnisses, die Erkämpfung einer von der Arbeiterklasse geführten und gemeinsam mit allen antimonopolitischen Kräften getragenen Staatsmacht zu Voraussetzung". Gerns erklärt aber nicht, weshalb die Arbeiterklasse, wenn sie in der Lage ist, die Kontrolle des Monopolkapitals über ihren Staat zu brechen, diesen Staat in Besitz nehmen soll, anstatt ihn durch einen Rätestaat zu ersetzen. Er erklärt nicht, weshalb sie sich bei entsprechender Veränderung des Kräfteverhältnisses zwischen den Klassen selbst beschränken sollte, um sich in einer Zwischenetappe einzurichten.
Tatsächlich gab es für die Zwischenetappe der DKP-Strategie nur eine plausible, materialistische Erklärung: Ihr Ausgangspunkt war, den internationalen Status Quo zwischen Ost und West nicht in Frage zu stellen, den die sowjetische Politik seinerzeit zur strategischen Leitlinie ihrer Politik gemacht hatte und der sich die stalinistischen Parteien der kapitalistischen Welt bei Strafe der Exkommunikation unterzuordnen hatten und in aller Regel untergeordnet haben. Deshalb wurde z.B. die sandinistische Politik in Nikaragua unterstützt, die das letzte Beispiel dafür war, daß eine solche Politik der bürgerlich-demokratischen Selbstbeschränkung schwere Niederlagen provoziert. Jetzt, nach dem Zusammenbruch der europäischen Arbeiterstaaten, verliert diese Etappenpolitik sogar den Anschein jeder Plausibilität.
Eine Zwischenetappe, in der die Arbeiterklasse das Monopolkapital von den Schalthebeln der staatlichen Macht verdrängt, hätte fatale Konsequenzen. Der Verzicht darauf, das Monopolkapital unverzüglich zu vergesellschaften, ließe dem Monopolkapital Zeit, sich zu reorganisieren und würde so entweder einem Militärputsch oder einem faschistischen Staatsstreich den Weg bereiten. Eine solche Entwicklung würde durch das Abbremsen der Mobilisierungen der Arbeiterklasse, durch das Vertrösten der Massenbewegung auf künftige Aktivitäten ihrer politischen Vertreter zumindest begünstigt. Auch der bestgemeinteste Versuch seitens subjektiv ehrlicher Stalinisten, eine Zwischenetappe zu konsolidieren, beruht deshalb auf einem totalen Unverständnis für die Dynamik von Klassenkämpfen und für den dialektischen Zusammenhang zwischen Volksfrontpolitik und anschließendem Triumph der Reaktion.
Gab und gibt es dazu eine Alternative?
Die Komintern hat zu Lebzeiten Lenins die Errichtung revolutionärer Arbeiterregierungen zum verbindlichen Ziel jeder Kommunistischen Partei erklärt. Deren Formen wurden im Einzelnen offengelassen. Das war natürlich weder gleichbedeutend mit einem politischen Amoklauf oder gar der abstrus sektiererischen Politik des 6. Weltkongresses, sondern sollte mit Hilfe der Einheitsfrontpolitik und auf der Basis von nationalen Übergangsprogrammen erreicht werden.
Die Volksfrontpolitik brach hinsichtlich der Ziele und der Kampfmethoden mit dieser Tradition.
Fehlende Aktualität der Übergangsstrategie?
Dies sehen wohl auch Hartwig Otto und Herbert Münchow so, die in ihrem sehr lesenwerten, weil sehr informativem Beitrag die Sicht Heinrich Brandlers und der KP(O) in den zwanziger Jahren referieren. Obwohl sie betonen, daß die Übergangskonzeption Resultat der Einschätzung war, daß sich der Kapitalismus trotz seiner grundsätzlichen Reife für den Übergang zum Sozialismus auf Zeit konsolidiert hatte, gehen sie aber in ihrer Schlußfolgerung wie die Gruppe Arbeiterpolitik davon aus, daß seit 1933 die objektiven Bedingungen für eine Übergangsstrategie fehlen.
Sie begründen die fehlende Aktualität einer Übergangskonzeption mit der These, daß sich nicht nur die objektiven Verhältnisse geändert haben, sondern auch die subjektiven: Es gebe keine reformistische Strömung mehr, die den Sozialismus als Ziel anstrebe und auch keine starke kommunistische Partei, nur eine Vielzahl von Kleingruppen.
Der Tiefstand der Bewegung sei ohne Beispiel, der Lebensstandard der Arbeiterklasse habe eine Konsumfixierung ohnegleichen gefördert und die Konkurrenz in der Arbeiterklasse gesteigert. Sie behaupten, eine neue politische Alternative könne sich erst herausbilden, wenn sich in der Arbeiterklasse wieder die Einsicht durchsetzt, daß sich ihre Probleme nicht dauerhaft im Kapitalismus lösen lassen.
Wäre das richtig, würde es für die Linke nur gelten, bis zu diesem Zeitpunkt mit Tagespolitik auf niedrigstem Niveau zu überwintern. Da wird als Strategie faktisch die rote Variante des Aussitzens vorgeschlagen.
Diese fatalistische Einschätzung fußt nicht nur auf einer Überschätzung der subjektiven Bindung der Arbeiterklasse an den Spätkapitalismus, sondern zunächst auf einer weit verbreiteten Idealisierung der Vergangenheit der Arbeiterbewegung und insbesondere des Klassenbewußtseins der sozialdemokratischen Wähler vor und auch noch nach 1914. Das abstrakte Bekenntnis der Anhänger der Sozialdemokratie zum Sozialismus war jedoch auch damals in den wenigsten Fällen mit politischer Klarheit in Bezug auf die Staatsfrage und hinsichtlich wirtschaftlicher Fragen verbunden und es bewegte sich weitgehend nur auf einem Niveau der Kritik am Kapitalismus, in dessen Zentrum sozialpolitische Gerechtigkeitsdefizite und spontane Abneigung gegen die Herrschenden standen. Sehr viel verbreiteter als heute war damals aber die Ansicht, daß der Kapitalismus der Arbeiterklasse keine dauerhaften Perspektiven bietet.
Beide Autoren überschätzen zudem rückwirkend den ideologischen Einfluß der KPD und dessen ideologische Qualität. Sie übersehen, daß die Wähler und Anhänger der KPD in der Weimarer Republik ihr zu einem nicht geringen Teil vor allem aus Wut und Verzweiflung anhingen und sich der KPD zuwandten, weil sie nur mit ihr einen Ausweg aus ihrer sozialen Misere erhofften, aber ohne klare Vorstellungen vom Sozialismus und dem Weg dahin. Die meisten dieser Anhänger waren vor allem Protestwähler. Das ist nicht wenig und ohne das Vertrauen derartiger Schichten der Arbeiterklasse ist eine soziale Revolution nicht möglich.
Angesichts der Revolutionsfeindlichkeit und des Antikommunismus der SPD-Führung konnte bereits in der Weimarer Republik eine Einheitsfront gerade nicht dadurch zustande kommen, daß unmittelbar der gemeinsame Kampf für den Sozialismus propagiert wurde. (Wieso Angela Klein darauf verfällt, die Übernahme der antikommunistischen Ideologie durch die Sozialdemokratie auf die Zeit nach dem 2. Weltkrieg zu datieren, bleibt unerfindlich: Die rechten Führer der Sozialdemokratien hatten die Oktoberrevolution und jede Art von Rätesystem und revolutionärem Sozialismus von Anfang an bekämpft.)
Einheitsfrontpolitik setzt keine schon sozialistischen Massen voraus,
sondern eine akute Krisenperiode des bürgerlichen Systems
Notwendiger Ansatzpunkt für die Einheitsfrontpolitik war viel mehr die Betonung gemeinsamer Tagesinteressen aller Strömungen der Arbeiterbewegung und später in der Weimarer Republik konkret die Betonung der Notwendigkeit einer gemeinsamen Abwehrfront gegen den Faschismus. Es galt in diesem Kampf für die Kommunisten, das Vertrauen auch der sozialdemokratischen Massen zu gewinnen und auf diese Weise den Kampf für die in einer späteren, entwickelteren Kampfphase in Angriff zu nehmende soziale Umwälzung vorzubereiten. Erfolgreiche Einheitsfrontpolitik auf der Basis eines Übergangsprogramms setzt deshalb nicht voraus, daß die Masse der Arbeiterklasse den Sozialismus will. Ganz im Gegenteil. Voraussetzung ist nur, daß relevante Teile der werktätigen Massen die Notwendigkeit von Abwehrkämpfen gegen die Politik der herrschenden Klasse sehen und eine interventionsfähige kommunistische Organisation auf der Höhe ihrer Zeit.
Die aber kommt ohne die Propagierung von zeitgemäßen Übergangsforderungen und ohne Mobilisierungsstrategie nicht aus. Selbstorganisation des Proletariats und seiner Bündnispartner, wachsende Kampferfahrungen der Massenbewegung und die Beiträge der Marxisten ermöglichen schließlich die Entwicklung sozialistischen Bewußtseins und damit das Heranreifen des subjektiven Faktors der Revolution, die Entwicklung der Klasse an sich zur Klasse für sich.
Grundlage der fatalistischen Konzeption der beiden Autoren ist dementsprechend das Versäumnis, in der Entwicklung der modernen gesellschaftlichen Verhältnisse, die Widersprüche zu sehen, die die klassenpolitische Lage dynamisieren können und die es deshalb bereits jetzt ermöglichen, die ersten kleinen Schritte auf dem Weg der Verwirklichung einer Übergangsstrategie zu gehen.
Die Glaubwürdigkeitskrise der Kommunisten
Manuel Kellner skizziert in seinem Referat den Kontext der Auseinandersetzungen in der Kommunistischen Internationale zu den Übergangsforderungen und führt richtig aus, daß in dieser Frage nur die IV. Internationale die politische Tradition der Kommunistischen Internationale aufrechterhalten hatte. Er vertritt die These, daß die Übergangsforderungen zwar an die Frage der Macht heranführen, aber dann auch die Frage "der bedrückenden Glaubwürdigkeitskrise der sozialistischen Alternative" aufgeworfen wird: "Was sollen wir sagen, wenn uns vorgehalten wird, dass im sogenannten >realexistierenden Sozialismus< (die Arbeiterklasse( eben nicht die Macht hatte, sondern eine Minderheit im Namen der Arbeiterklasse?" Manuel Kellner schlägt deshalb vor, der Glaubwürdigkeitskrise der Kommunisten entgegenzuarbeiten, in dem zu den Quellen zurückgekehrt wird. Die Kommunisten sollen sich wieder am Modell der Pariser Kommune mit ihren demokratischen Formen der Selbstorganisation orientieren.
Manuel Kellner vermengt hier zwei Probleme miteinander, die getrennt behandelt und gelöst werden müssen:
Die große Masse der Klasse der Lohnabhängigen wird sich erst am Ende einer längeren Kette von Klassenkämpfen und Auseinandersetzungen ernsthaft mit der Frage der Durchsetzung einer sozialistischen Systemalternative beschäftigen, nämlich dann, wenn sie das Gefühl hat, im Kapitalismus keine Zukunftsperspektiven mehr zu haben und sie die Notwenigkeit begreift, ihre Geschicke in die eigenen Hände zu nehmen. Dann werden große Teile der Arbeiterklasse begriffen haben, daß eine Bürokratisierung nur dort stattfinden kann, wo die Arbeiterklasse noch nicht bzw. nicht mehr die Kraft hat, ihre Geschicke selbst zu bestimmen. Bis dahin wird sie mehrheitlich allen Sozialisten und Kommunisten mißtrauen - nicht zuletzt auf Grund ihrer Erfahrungen mit dem realen Stalinismus (und natürlich der dadurch (!) auf fruchtbaren Boden gefallenen bürgerlichen, antikommunistischen Propaganda). Das Mißtrauen der breiten Masse der Lohnabhängigen gegenüber Marxisten kann nur dadurch überwunden werden, daß diese in den praktischen Kämpfen der Massenbewegung beweisen, daß sie mit allen stalinistischen Praktiken gebrochen haben. Die Furcht vor einer Neuauflage des Stalinismus wird aber so lange virulent bleiben, wie Stalinisten in der Massenbewegung noch eine Rolle spielen. Für konsequente Marxisten bedeutet das, daß sie auf dem Weg zur sozialen Revolution einzelnen sich radikalisierenden Teilen der Arbeiterklasse immer wieder beweisen müssen, daß sie sich ernsthaft mit den gesellschaftlichen Defiziten in den Arbeiterstaaten auseinandergesetzt haben.
Da stalinistische Betonköpfe noch nicht ausgestorben sind und ja leider immer noch Nachwuchs finden, ist diese Auseinandersetzung auch eine Auseinandersetzung zwischen Strömungen in der aktuellen Bewegung. Es gibt daher auf individuelle Fragen sich radikalisierender Kräfte in der Bewegungbei der Beantwortung kein "wir", das Stalinisten und NIcht-Stalinisten einschließt, ebenso wie es auf solche Fragen keine gemeinsamen Antworten von Marxisten und Sozialdemokraten jeglicher Couleur gibt. Auch hier gilt: Der Weg zur Gemeinsamkeit führt über Klarheit in der Sache.
Entscheidendes Element der Übergangsstrategie bleibt also nicht ein leider fiktiver Bruch aller Antikapitalisten mit dem Stalinismus, sondern die Entwicklung und das Vorantreiben des realen Klassenkampfs. Dabei stellt sich die Frage nach den Zielen, der Strategie, der Rolle und Funktion einer Partei bzw. von Marxisten in der Massenbewegung.
Christoph Jünke, Angela Klein und Manuel Kellner appellierten an die Konferenzteilnehmer, den Substitutionismus, das Stellvertreterdenken, aufzugeben. Angela Klein spricht von der Zentralität des Subjekts. Die Arbeiterklasse selbst müsse sich ihrer Rolle und Kraft bewußt werden. Es gelte, die Arbeiterbewegung auf gewerkschaftlicher und politischer Ebene neu zu formieren. Auf einer solchen Abstraktionsebene kann man dem nur zustimmen.
Angela Klein sieht dann das Projekt der Europäischen Antikapitalistischen Linken als Bestandteil dieses Neuformierungsprozesses. Sie betreibt dabei zugleich einen unterschiedslosen Bewegungsfetischismus, der Bewegung unabhängig von Inhalten bejubelt. So propagiert sie die partizipative Demokratie der Kommunalpolitik in Porto Allegre (Brasilien), wo Bürger die Möglichkeit haben, über einen Teil des Kommunalhaushalts zu entscheiden, als Ansatz zu Doppelmacht. Tatsächlich dürfte es sich eher um die Einbindung der Massenbewegung in den bürgerlichen Staat handeln. Die Bewegung wird so an die Rationen gewöhnt, die der bürgerliche Zentralstaat seinen Kommunen zubilligt und lernt auf diese Weise, diese Grenzen als realistischen und strategischen Rahmen zu akzeptieren. Die Einbindung von Massenstrukturen in den bürgerlichen Staat kann nur fatale Konsequenzen für jede Massenbewegung haben.
Hier verläßt Angela Klein die revolutionären Traditionslinien der Kommunistischen Internationale.
So sehr es richtig ist hervorzuheben, daß die Arbeiterklasse selbst das reale Subjekt der gesellschaftlichen Umwälzungen ist, so unrichtig ist es weiter, die in diesen gesellschaftlichen Bewegungen aktiven politischen Parteien als Teile zu verstehen, die denselben Bewegungsgesetzen wie die Bewegung insgesamt unterworfen sind.
Politische Parteien werden ihr Handeln immer entsprechend ihren Lehren aus der Geschichte, ihren politischen Traditionen und als Resultat ihrer intensiveren und tiefergehenden Debatten und Analysen ausrichten. Sie beeinflussen die Massenbewegung und konkurrieren miteinander im Kampf um Einfluß auf den weiteren Gang der Bewegung. Politische Sammelparteien sind davon nicht ausgenommen. Sie erschweren aber auf Grund ihres unklaren Profils den weiteren Bewußtwerdungsprozeß der Massenbewegung selbst und blockieren ihn schlimmstenfalls. Klarheit in den zentralen politischen Fragen ist deshalb unabdingbar. Diese Einsicht war (der später verloren gegangene) Gründungskonsens der Kommunistischen Internationale.
16.08.2004