| Startseite | Impressum | Suchen | Rubrik: PDS | 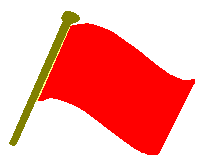 |
Schuldzuweisung.
Zur Wahlniederlage der PDS
Wer mit 5,1 % der Stimmen im Bundestag sitzt, kann sich jedenfalls in der Periode kurz vor einer Wahl bei annähernd gleich bleibenden gesellschaftlichen Verhältnissen wenig gravierende taktische Fehler erlauben. Sonst landet er womöglich bei 4,9 %. 1 % zu verlieren bedeutet für die SPD wenig. Für eine 5 %-Partei heißt es, daß jeder fünfte Wähler verloren wurde. Das ist ein Erdrutsch. Wer erdrutschartige Verluste erleidet, hat nicht nur taktische Fehler gemacht. Er hat seine Partei auf einen strategischen Holzweg geführt.
Wir lehnen es deshalb ab, darüber zu lamentieren, ob Gabriele Zimmer genügend Emotionalität über deutsche Bildschirme ausgestrahlt hat oder ob es richtig gewesen ist, ein Führungsquartett zu präsentieren. Weder "die Flut", noch Schröders Besetzung des Themas Frieden sind für das Debakel der PDS in erster Linie ursächlich. Entscheidend war auch nicht, die "Falle" Stoiber oder Schröder. Eine solche "Falle" hat es noch bei jeder Wahl gegeben. Die taktischen Fehlleistungen waren zwar, wie Mäde, Menzner, Jelpke, Wolf und Lieberam in ihrem Papier "Sozialdemokratisierung muß die PDS zerstören" überzeugend und detailliert nachgewiesen haben, schon allein ausreichend, um die Wahl zu verlieren. Auf taktischem Gebiet haben Bartsch & Compagnie denselben taktischen Dilettantismus an den Tag gelegt wie beim Geraer Parteitag.
Entscheidend ist aber zunächst, daß sich das Verhältnis der PDS zu einem sehr erheblichen Teil ihrer Wählerbasis grundlegend verändert hat und daß es die PDS nicht vermochte, das Vertrauen von Teilen der bisherigen Wählerbasis in erster Linie von SPD und Grünen zu gewinnen. So konnten es sich die Kriegsparteien SPD und Grüne vier Jahre lang erlauben, Sozialpolitik gegen ihre eigene Wählerbasis zu betreiben und deren Hoffnungen auf Frieden zu enttäuschen. Der Vertrauensverlust bei den eigenen Wählern und die Enttäuschung inzwischen wechselbereiter Wähler sind nicht nur das Ergebnis taktischer Fehler dieses oder jenes Bries, Bartschs, Gysis, Sittes oder Holters in der jüngsten Zeit, sondern zwangläufiges Resultat einer grundlegend falschen und die PDS letztlich zerstörenden politischen Orientierung.
Die Ziele, für die die Gebrüder Brie, Dieter Klein, Gregor Gysi, Lothar Bisky, Bartsch, Pau, Holter und Claus standen, lassen sich wie folgt zusammenfassen: Aussöhnung mit dem Kapitalismus, Akzeptanz sogenannter kapitalistischer Sachzwänge, Ersetzung sozialistischer Ziele durch kapitalistische Modernisierungskonzepte, Anpassung an eine von ihnen selbst idealisierte Sozialdemokratie bis hin zur Mitgestaltung neoliberaler, sprich: reaktionärer bürgerlicher Politik. Diese Strategie ist nicht neu. Sie wird mit aller Energie seit 1990 verfolgt, aber nie offen bekannt. Die sich selbst gern so bezeichnenden Reformer der PDS erfinden deshalb ständig neue Terminologien und scheuen jede klärende Diskussion. Dies hat naheliegende Gründe: Die dog. Reformer wissen, daß sowohl innerhalb der PDS wie außerhalb der Partei diese Ziele so offen formuliert nicht geteilt werden.
Parteien, Klassen und die PDS
Um die Entwicklung des Verhältnisses der PDS zu ihrer Wählerbasis umfassend zu verstehen, müssen wir über ein Phänomen sprechen, das die PDS-Führung seit 1990 nicht mehr kennen will, nämlich über Klassen. Die bürgerliche Gesellschaft ist bekanntlich eine Klassengesellschaft und die Parteien dieser Klassengesellschaft überleben auf eine gewisse Dauer nur, soweit sie es schaffen, von den Klassen dieser Gesellschaft oder doch wenigstens von Teilen dieser Klassen als ihre politische Interessenvertretung akzeptiert zu werden.
Das Verhältnis jeder Partei zu ihrer eigenen, einmal erworbenen Basis kann dabei sowohl als Vertrauensverhältnis wie gleichzeitig auch als distanziertes Mißtrauensverhältnis beschrieben werden.
Aber auch das Verhältnis derselben Basis zu anderen, konkurrierenden Parteien läßt sich als eines im Spannungsfeld von Vertrauen und Mißtrauen beschreiben. Der "eigenen" Partei wird lediglich weniger mißtraut und in der Regel mehr zugetraut, wenn es um die Vertretung der Interessen der betreffenden Basis geht. Berücksichtigt werden muß dabei aber, daß Bindungen zur "eigenen" Partei in der Regel auf stark prägenden Erfahrungen beruhen und sich selten allein durch kurzfristige Entwicklungen oder durch reine Medienereignisse erschüttern lassen. Derartige Bindungen werden nur durch große historische Erschütterungen gelöst oder, vergleichbar mit einer Ehe, nur durch eine Vielzahl von Enttäuschungen zerrüttet. Dementsprechend ist es schwer, einmal verlorenes Vertrauen wieder zu gewinnen. Aber es ist möglich, weil jede soziale Gruppe eine politische Interessenvertretung braucht.
Die eigene Interessenlage braucht dabei der jeweiligen Klasse oder den betreffenden Teilen der Klasse nicht umfassend bewußt zu sein. Dies ist bekanntlich meistens nur diffus und auf kurze Sicht der Fall. Hinzu kommt, daß die je eigenen Klasseninteressen der Bourgeoisie wesentlich bewußter sind, als der Arbeiterklasse. Aber alle Erfahrungen zeigen, daß die sozialen Interessen der jeweiligen Basis der Parteien von diesen nicht ungestraft ignoriert werden können. In dieser Hinsicht ist es letztlich gleichgültig, welche politischen, ideologischen und kulturellen Traditionen und welche Erfahrungen die jeweiligen Klassen prägen. Diese Traditionen und Erfahrungen sind allerdings von enormer Bedeutung, wenn es um die Frage geht, wie die jeweiligen Klassen und ihre Bestandteile die aktuellen Erfahrungen mit "ihrer" Partei und anderen Parteien verarbeiten.
Jede Analyse der politischen Landschaft der BRD wird deshalb auf absehbare Zeit die unterschiedliche soziokulturelle Prägung der deutschen Klassengesellschaft in Ost und West berücksichtigen müssen.
Die Lage im Osten
Ost und West haben inzwischen allerdings eine Klasse gemeinsam: Die Großbourgeoisie. Das Staatseigentum der Arbeiterklasse wurde, soweit es nicht vernichtet wurde, zunächst entwertet und dann von der westdeutschen Bourgeoisie angeeignet. Diese wurde dadurch unmittelbar wieder zu einer gesamtdeutschen Klasse. Aber die Arbeiterklasse in der DDR hat mit dieser andere Erfahrungen gemacht als die im Westen.
Eine ostdeutsche Bourgeoisie entstand nur als (teils sogar prekäre) Kleinbourgeoisie, die vom bürgerlichen Staat und von der Großbourgeoisie in vielen Fällen nicht als ebenbürtiger Partner anerkannt wird, sich aber in den Kleinbetrieben genauso reaktionär verhält, wie alle in die Enge getriebenen Kapitalisten. Die PDS schweigt zu den Zuständen in diesen Kleinbetrieben und bemüht sich in den Kommunen und Ländern um eine Mittlerstellung zwischen Großkapital und der neuen Ostbourgeoisie. Christine Ostrowski nahm gegen die Arbeiterklasse sogar ausdrücklich Partei für diese Kleinbourgeoisie. Dies wird von der neuen Ostkleinbourgeoisie mit Ausnahme eines Teils der in die Selbständigkeit geflüchteten alten Kader der SED aber wenig honoriert und hilft schon gar nicht, den Anhang der PDS in der Arbeiterklasse zu verbreitern.
Die Zerschlagung und Aneignung des Staatseigentums an 1990 bewies nicht nur erneut, daß die Eigentumsfrage die Grundfrage des Kapitalismus ist, sondern sie zerschlug die bis 1989/1990 bestehende Struktur und den sozialen Zusammenhalt der DDR-Arbeiterklasse. Die Arbeiterklasse wurde atomisiert, gespalten, desorientiert und in politische Sackgassen getrieben - bis hin zu Streiks für Privatisierungen, um wenigstens einen kleinen Teil an Arbeitsplätzen in zerstörten Betrieben zu erhalten. Dies war möglich, weil die SED mit ihrer Politik größte Teile der Arbeiterklasse dem Sozialismus entfremdet hatte und weil die PDS ab 1990 jeden politischen Widerstand gegen die Zerschlagung des Staatseigentums aufgegeben hatte, beginnend mit ihrem eigenen Rückzug aus den Betrieben.
Damit hatte es die PDS versäumt, den Grundstein dafür zu legen, diejenigen Teile der Arbeiterklasse für einen sozialistischen Neuanfang zu gewinnen, die mit ihren schon vor 1989 entwickelten Riesenillusionen in den Kapitalismus, vom real existierenden deutschen Imperialismus, von CDU, FDP und SPD enttäuscht werden sollten. Das Vertrauen dieser Teile der Arbeiterklasse war mit wolkigen Reformversprechen und praktischem Versagen in der nur-parlamentarischen Opposition nicht zu gewinnen. Ein Teil der Arbeiterklasse wurde so zu einem politisch vagabundierenden Protestwählerpotential, das impressionistisch zwischen der Wahl von CDU, SPD, FDP, DVU, PDS und Wahlboykott schwankt und keine politische Kraft sieht, die glaubwürdig ist, Veränderungen will und für diese kämpft. Die PDS hat diese Schichten der Arbeiterklasse faktisch abgeschrieben. Sachsen-Anhalt ist hierfür das beste, aber nicht das einzige Beispiel.
Die PDS stützte sich statt dessen auf die sog. Intelligenz, d.h. die höher qualifizierten Schichten der Arbeiterklasse, die zu einem nicht unerheblichen Teil den Arbeiterstaat DDR gestützt hatten. Ein Teil dieser Schichten wurde in der BRD sogar ökonomisch besser gestellt als in der DDR, nicht zuletzt viele Rentner. Aber selbst diese Teile erlitten einen soziokulturellen Funktions- und Bedeutungsverlust bzw. sahen ihre Lebensleistungen mißachtet. Große Teile dieser Schichten der Arbeiterklasse bzw. der Intelligenz wurden jedoch abgewickelt, in die Arbeitslosigkeit gedrängt, mußten andere, minder qualifizierte Berufe ergreifen und wurden an den Rand der bürgerlichen Gesellschaft gedrängt.
Diejenigen, die Arbeit haben, sehen sich mit andauernder Diskriminierung gegenüber der westdeutschen Arbeiterklasse, mit niedrigeren Löhnen, längeren Arbeitszeiten, einer schlechteren Altersversorgung, größerer Arbeitsplatzunsicherheit und arbeitslosen Familienangehörigen etc. konfrontiert. Auch, wenn große Teile dieser Schichten der Arbeiterklasse mit ihrem Lebensstandard relativ zufrieden sind, wird doch gesehen, daß der Kapitalismus diesen Standard nur auf Abruf gewährleistet und daß immer mehr Errungenschaften in Frage gestellt und ausgehöhlt werden. Diese Schichten der Arbeiterklasse fühlen sich verunsichert und bedrängt. Sie erwarten von der PDS zumindest eine Politik, die ihre Lebensleistungen anerkennt, die den erreichten Lebensstandard sichert und zumindest auf Westniveau bringt.
Die PDS-Führung hat ihnen jahrelang versprochen, eine solche Politik zu machen. Die Anpassung an die neoliberale Politik der SPD in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin hat diesen Schichten der Arbeiterklasse inzwischen aber deutlich signalisiert, daß sie einer Illusion in die PDS bzw. ihrer Führung aufgesessen sind. Die letzten Wahlergebnisse zeigen, daß diese Signale angekommen sind.
Selbst da, wo große Teile der ostdeutschen Arbeiterklasse, und zwar weit über die Basis der PDS hinaus, eine Grundposition der PDS teilen, nämlich ihre Haltung gegen die Beteiligung der Bundeswehr an Kriegseinsätzen, hat die PDS-Führung seit dem Münsteraner Parteitag und haben Politiker wie Gysi und Claus signalisiert, daß sie diese Haltung über den Haufen werfen wollen. Das zwangsläufige Resultat dieser Politik war eine breite Abwendung von der PDS, die Wahlenthaltung oder sogar die Wahl der SPD, um wenigstens Stoiber zu verhindern.
Der Lage im Westen und der steinige Weg der PDS
Die Klassenstruktur der alten BRD weist demgegenüber immer noch und wohl noch auf absehbare eine deutlich größere Stabilität aus.
Die klassische Arbeiterbewegung wurde faktisch seit Gründung der BRD von der Sozialdemokratie politisch und organisatorisch kontrolliert. Die SPD war aber nicht in der Lage, sich und ihre Politik auf die strukturellen Veränderungen in der Arbeiterklasse einzustellen: Die objektive Verproletarisierung der Gesellschaft (Bauern, traditionelles Handwerk), die Entstehung neuer, proletarischer Mittelschichten, neue berufliche Qualifikationen erheblicher Teile der Arbeiterklasse (technische Intelligenz) und der "Abstieg" majoritärer Teile der Angestellten in die Arbeiterklasse. Die einzige Veränderung, die sie wahrnehmen wollte, war der nach dem Krieg gestiegene Lebensstandard. Sie verkündete deshalb schon in den 60-er Jahren das Ende der Klassengesellschaft.
Die 68-er-Bewegung entstand dann im wesentlichen als eine Jugendrevolte, deren Mobilisierungskraft sich aus den Modernisierungsdefiziten des Ausbildungssektors der bundesdeutschen Gesellschaft, aber auch aus den ideologischen Widersprüchen der bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft speiste. Dieser politisch und ideologisch unter dem Einfluß der vietnamesischen Revolution, dem Prager Frühling, der chinesischen Kulturrevolution und des Französischen Generalstreiks im Mai 1968 schnell weit aufgefächerten Bewegung gelang es, Ende der 60-er Jahre das politische Klima der BRD einschneidend zu verändern und in gewisser Hinsicht eine tatsächliche Kulturrevolution zu bewirken.
Dies schuf die Voraussetzungen für die Erosion des damals unumstößlich festgefügt wirkenden Parteiensystems der BRD und führte links von der SPD zur Entstehung der Grünen. Diese wiederum zollten im Verlauf der 80-er und 90-er Jahre dem sich im Gefolge der Niederlagen der verschiedenen politischen und sozialen Bewegungen nach rechts verschiebenden Kräfteverhältnis Tribut, insbesondere auch nach dem Zusammenbruch der DDR. Die linkeren Kräfte in den Grünen resignierten oder paßten sich der kapitalistischen Gesellschaft und der sozialdemokratischen Variante bürgerlicher Politik an. Dieser Prozeß wurde dadurch begünstigt, daß große Teile der grünen Basis als Teil der neuen proletarischen Mittelschichten einen halbwegs komfortablen Platz in der westdeutschen bürgerlichen Gesellschaft fanden.
Es wäre aber ein großer Irrtum anzunehmen, daß die gesamte Basis der Grünen mit deren politischer Entwicklung zufrieden ist. Erhebliche Teile dieser Basis hat die rotgrüne Kriegspolitik an den Rand des politischen Bruchs mit den Grünen geführt. Dies hatte sich klar und deutlich bei der letzten Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus gezeigt. Seinerzeit gelang es der PDS erstmals, auf Kosten vor allem der Grünen in Westberlin außerhalb Kreuzbergs erhebliche Stimmengewinne zu erzielen. Diesen Zugewinn haben Liebich, Wolf und Co. inzwischen wieder verspielt. Die PDS bewegt sich im Westen wieder im Ghetto derjenigen Wählergruppe von Altlinken, die schon 1990 mit SPD und Grünen gebrochen hatten und daher für die PDS problemlos ansprechbar waren.
Aber auch jenseits des linken Milieus der alten BRD gibt es erhebliche Teile der Arbeiterklasse, die hinter den Glitzerfassaden der kapitalistischen Gesellschaft verarmt sind, die keinen nennenswerten Anteil am vordergründigen Wohlstand der BRD haben, die arbeitslos sind und sich von den westdeutschen Parteien nicht oder nicht mehr vertreten fühlen. Und es gibt eine Vielzahl von Kräften, die eine bessere und solidarischere Gesellschaft wollen. Alle diese Kräfte sind für eine sozialistische Partei ansprechbar. Ihr Vertrauen muß in gemeinsamen Kämpfen gewonnen werden. Dann kann es auch im Westen eine Renaissance der sozialistischen Bewegung geben.
Mit der bisherigen Politik der PDS ist ein Ausbruch aus dem 1,1 %-Ghetto im Westen kaum möglich. Eine Politik mit zunehmend sozialdemokratischem Profil im Osten strahlt auch negativ in der Westen aus und muß jeden Ansatz zunichte machen, unzufriedene Anhänger bzw. Wähler der SPD oder der Grünen zu gewinnen. Ebenso wie die Grünen nur als klare Alternative zur SPD entstehen konnten, kann eine neue sozialistische Kraft nur entstehen als glaubwürdige Alternative zu den Grünen und zur Sozialdemokratie.
Das seit 1990 verfolgte Konzept der PDS-Strategen, sich im Osten an die SPD anzupassen und Gysi Dank seiner Talkshow-Auftritte im Westen Illusionen in den sozialistischen Charakter der PDS-Politik schüren zu lassen, funktionierte zu keinem Zeitpunkt. Die Mauer zwischen Ost und West ist nicht hoch genug, um jeden Blick der Arbeiterklasse im Westen auf die reale Politik der PDS im Osten zu versperren. Die gescheiterte Westausdehnung der PDS ist deshalb nicht dem "Antikommunismus" im Westen geschuldet, sondern zwangsläufiges Resultat des Kurses der PDS-Führung.
Die Grünen sind das beste Beispiel dafür, daß die Anpassung an die Sozialdemokratie zwangsläufig in eine Entwicklungsblockade hineinführt: Wer sich selbst anpaßt, kann Noch-Anhängern der Sozialdemokratie nicht mehr vermitteln, daß eine Alternative zur Sozialdemokratie notwendig ist. Damit wird zugleich die Veränderung des Kräfteverhältnisses nach links ausgeschlossen und die sozialdemokratische Politik erscheint den Ideologen der Anpassung daher zunehmend selbst als alternativlose, als einzig realistische Politik. Das war so bei den Grünen und wiederholt sich auf vergleichbar niedrigem Niveau bei Gysi, Bartsch und ihren Freunden. Die Ironie der Geschichte ist, daß gerade in einer Phase, in der die SPD und auch die Grünen ihre Basis zutiefst enttäuschen, die rechten PDS-Führer keinen anderen Weg sehen, als den, sich in Koalitionen gemeinsam mit der Sozialdemokratie gemein zu machen und sich so zu diskreditieren. Damit tun sie alles, um die wankende Position der SPD wieder zu festigen. Brie, Gysi und Co. sind nicht nur Ärzte am Krankenbett des Kapitalismus, sondern sie haben aus der PDS eine Frischzellenkur für die kränkelnde SPD gemacht. Die Wählerverluste in Richtung SPD sind ihr Werk.
Neben der SPD können sich die angepaßten, nur noch ehemals linken Kräfte allenfalls dann halten, wenn sie sich Dank des neoliberalen Kurses der SPD als linker Flügel des Reformismus präsentieren können. Schröders Irak-Politik hat aber gezeigt, daß auch eine neoliberale Sozialdemokratie in Vorwahlperioden für scheinlinke Überraschungen jederzeit gut ist. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die Versprechungen La Fontaines vor der Wahl 1998. Die PDS-Wahlkampfstrategen waren durch die Haltung Schröders, eine deutsche Kriegsbeteiligung auch bei Erteilung eines UN-Mandats auszuschließen, links überholt worden und reagierten kopflos. Sie fanden weder im Osten noch im Westen irgendeine Antwort, weil sie schon im Vorfeld nicht vom prinzipiellen Standpunkt der Arbeiterklasse gegen jeden imperialistischen Krieg aus, sondern vom taktischen Interesse der deutschen Bourgeoisie an der Einhaltung völkerrechtlicher Normen argumentiert hatten. Gysi, Claus und ihre Freunde können sich eine Zustimmung zu deutschen Militäreinsätzen mit UN-Mandat bekanntlich problemlos vorstellen. Sie haben nicht begriffen, daß dies im Falle des Irak nicht den strategischen Interessen der deutschen Bourgeoisie entspricht und deshalb eine Abgrenzung zur SPD in diesem Falle scheitert. Pech gehabt. Bürgerliche Politik können sie auch nicht.
Ist eine Alternative möglich?
Selbstverständlich. Es muß zunächst mit der Illusion aufgeräumt werden, als seien Ost und West zwei völlig verschiedene Welten. Sozialistische Politik ist als provinziell beschränkte Politik nicht möglich, auch nicht als "Ostpolitik". Es müssen schon die Interessen der gesamten Arbeiterklasse sein, ohne geographische Beschränkungen. Das schließt den Widerstand und den Kampf gegen die Benachteiligung und Diskriminierung der ostdeutschen Arbeiterklasse nicht nur nicht aus, sondern erfordert es, diesen Kampf zu einem Eckpfeiler sozialistischer Politik in der Ex-DDR zu machen. Dies aber hat die PDS bisher nicht konsequent getan. Schon gar nicht in den Betrieben und auf der Straße. Das erforderte die schärfste Opposition in den Landesparlamenten und den Bruch mit der Praxis, den kapitalistisch produzierten Mangel mitzuverwalten und zum akzeptierten Rahmen sozialistischer Politik zu machen.
Wenn die PDS im Osten kämpft, wird sie auch im Westen schnell zum Anziehungspol für diejenigen, die Veränderungen wollen. Als gesamtdeutsche Kraft hat eine sozialistische Partei, die ihren Namen verdient, die Möglichkeit, die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse nachhaltig zu dynamisieren, nach links zu verschieben und so an der Entstehung neuer gesellschaftlicher Mehrheiten mitzuwirken. Nur eine Partei, die die Kräfteverhältnisse nach links verschiebt, kann für die Arbeiterklasse tatsächlich spürbare Veränderungen durchsetzen. Dies ist möglich, weil die ökonomische Stagnation und die nachhaltigen Versuche der Bourgeoisie, neue Spielräume durch eine Umverteilung von untern nach oben zu gewinnen, zu neuen Radikalisierungsprozessen führen können.
Eine solche Politik schließt eine Anpassung an die Sozialdemokratie aus, nicht aber die Zusammenarbeit mit Sozialdemokraten und Grünen, schon gar nicht auf außerparlamentarischer Ebene. Im Gegenteil. Reden wir Klartext: Koalitionen mit der SPD und Grünen sind zumindest unter den gegebenen gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen nicht ohne die Kapitulation vor der heutigen sozialdemokratischen Politik zu haben. Die SPD-Führung zieht erklärtermaßen eine Koalition mit bürgerlichen Parteien sogar jeder inhaltlich begrenzten, aber ernsthaften Reformkoalition vor. Sie ist bis zur Selbstaufgabe entschlossen, bürgerliche Politik durchzusetzen. Die Organisierung gesellschaftlichen Drucks läßt sie und andere bürgerliche Parteien aber unter Umständen auch echte Reformen beschließen. Druck in diesem Sinne ist ohne eine entschlossene und aktive Oppositionspolitik der Sozialisten vor allem außerhalb der Parlamente nicht möglich.
Die punktuelle Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie ist sowohl parlamentarisch wie außerparlamentarisch notwendiger Bestandteil einer aktionsorientierten und massenwirksamen Oppositionspolitik. Aber das bedeutet zugleich eine ständige Konfliktlinie zu schaffen und nicht, ein politisches Liebesverhältnis zu beginnen. Die SPD wird klagen, die Sozialisten würden die parlamentarische Verantwortung und damit überhaupt Verantwortung scheuen. Es liegt an den Sozialisten, in der Öffentlichkeit klar zu machen, welche Politik sie verantworten wollen und welche nicht. Es kommt darauf an, wer wen entzaubert. Hierauf verzichten könnten Sozialisten nur, wenn auch die SPD die Interessen der Arbeiterklasse zur Richtschnur ihres Handelns machte. Damit kann niemand rechnen. Es bleibt deshalb auf absehbare Zeit dabei: Veränderung beginnt mit Opposition. Nur über eine klare Oppositionspolitik vor allem außerhalb der Parlamente kann die Bourgeoisie gezwungen werden, der Arbeiterklasse Zugeständnisse zu machen. Und Parlamentsarbeit ist nur nützlich, wenn sie hilft, eine gesellschaftliche Opposition gegen die jetzt herrschenden Verhältnisse zu entwickeln.
Dieter Elken
25.10.2002