| Startseite | Impressum | Suchen | Rubrik: PDS / Linkspartei | 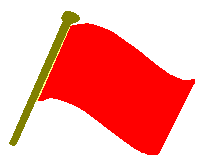 |
Was wird aus der WASG-Linken?
Die WASG ist mit dem Anspruch gegründet worden, den politischen Widerstand gegen die neoliberale Politik der rotgrünen Koalition zu forcieren und für eine gesellschaftliche Alternative zu kämpfen. Die wachsende Unzufriedenheit der SPD-Basis mit der Politik der rotgrünen Koalition, der aufbrechende Graben zwischen den Wählerinnen und Wählern der alten Parteien der Linken und den Führungen dieser Parteien, die mit ihrer Politik ihre eigene Wählerbasis angriffen, setzten ab 2003 Spekulationen über Möglichkeiten auf die Tagesordnung, mit einem neuen linken Parteiprojekt kurzfristig die 5%-Hürde bei Wahlen überwinden zu können.
Viele Linke entwickelten Hoffnungen auf einen großen Durchbruch, als nach links strebenden Gewekschaftsfunktionäre um Klaus Ernst ebenfalls eine Wahlalternative anstrebten. Sie übersahen, daß die Strömung des Gewerkschaftsapparats, die den Stachel gegen die Schrödersche Politik löckte, bis dahin keinen erkennbaren nennenswerten praktischen Widerstand gegen den Neoliberalismus geleistet hatte. Bis zum heutigen Tag sind diese Kräfte jeden Beweis dafür schuldig geblieben, daß sie den außerparlamentarischen Widerstand der Gewerkschaften seit der WASG-Gründung belebt hätten. Es hat sich inzwischen auch erwiesen, daß fast alle Linken deren politische Zugkraft auf Teile der sozialdemokratisch orientierten Gewerkschaftsbasis völlig überschätzt haben. Das gilt auch für Lafontaine, der eher umgekehrt darauf gehofft hat, daß ihm die Linken eine neue Basis verschaffen würden..
Die Gruppe Klaus Ernst, die sich in der Schröderschen Politik nicht mehr wiederfand und sich eine neue politische Hausmacht verschaffen wollten, verzögerte die Parteigründung. Ganz in bürokratischen Politikmustern befangen hoffte sie, durch einen Aufbau streng "von oben nach unten" von ihr nicht kontrollierbare Entwicklungen verhindern zu können. Sie bremste nicht nur die anfängliche Aufbruchstimmung. Verhindert hat sie im Bündnis mit anderen reformistischen Strömungen, daß die WASG gegen die zeitgemäße kapitalistische Politik, den Neoliberalismus, ein ebenso zeitgemäßes, offen sozialistisches Projekt formulierte. Ihr neoreformistisches Projekt einer offenen Sammelbewegung von geläuterten Reformkommunisten bis hin zu enttäuschten Christlich-Sozialen erwies sich als Wunschdenken fernab der sozialen Realität.
Der frühe Kindstod des Gründungsprojekts der WASG
Als sich nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen und der kurzfristig über die Führung der WASG hereinbrechenden Bundestagswahl abzeichnete, daß sowohl die PDS als auch die WASG Opfer der 5%-Klausel werden könnten, entschloß sich die reformistische Spitze der WASG, um jeden Preis mit der PDS zu fusionieren.
Dahinter stand bereits die Erkenntnis des Scheiterns ihres strategischen Projekts. Ihr Fazit und ihr weiteres Motto: Für Parlamentsmandate tun wir alles. Einzige Vorbedingung: Die PDS hatte sich umzubenennen. Lafontaine, Ernst & Co. hofften offenbar, durch rhetorische Opposition im Bundesparlament wenigstens bis zur nächsten Wahl ihre faktisch bedingungslose Kapitulation vor dem PDS-Apparat und seiner von ihm betriebenen neoliberalen Realpolitik in den neuen Ländern kaschieren zu können.
Dieses Kalkül ist, dank der Berliner WASG nicht aufgegangen, die mit dem Protest gegen die neoliberale Politik des SPD-L/PDS-Senats eng verbunden ist und damit dessen wichtigste Stimme geworden ist. Leider geht die Berliner WASG über die (richtige) Negation des Neoliberalismus und das Versprechen, gegen ihn energische Opposition betreiben zu wollen, nicht hinaus. Die PDS hat in früheren Wahlkämpfen einmal den (guten) Slogan verbreitet "Veränderung beginnt mit Opposition". Sie hatte sich aber dazu ausgeschwiegen, wohin ihre Opposition führen sollte. Bei ihrer Führung war das demagogisches Kalkül. Leider ist dazu auch von der Berliner WASG nichts zu hören, die weder für sich noch für ihre Anhänger klare Zukunftsperspektiven formuliert. Das ist in diesem Falle Ausdruck politischer Schwäche der berliner WASG-Führung, die ihre Anziehungskraft schwächt.
Die Linkspartei/PDS führt unterdes Lafontaine und seine vieldeutigen Erklärungen und theoretisch zwielichtigen Manifeste zur neuen Linkspartei als demagogisches und verlogenes Gewäsch vor. Sie erklärt den Berlinern, daß es weitergeht, wie bisher. Und wie zum Hohn bricht sie schon vor der Wahl ihre Wahlversprechen ausgerechnet in der Frage, die Lafontaine (absurderweise zur einzigen) Gretchenfrage in Sachen Neoliberalismus erklärt hat, der Frage nach der Privatisierung kommunalen Eigentums: Der Senat will unmittelbar nach der Wahl weitere1600 Wohnungen privatisieren.
Und der Bundesvorstand der WASG? Er betreibt weiter den Beitritt zu einer Partei, die in Berlin alle die sozialen Grausamkeiten aktiv mitträgt und betreibt, gegen die die WASG-Gründung erfolgte. Statt den politischen Lumpereien der Liebich, Wolf und Co. entgegenzutreten, wird der Wahlkämpf der L/PDS unterstützt. Lafontaine entblödet sich nicht, bei der Eröffnung der heißen Wahlkampfphase den Neoliberalismus auf Berliner Landesebene zu einem exclusiven Problem der SPD zu erklären und die allein gegen diese neoliberale Politk kämpfende Berliner WASG als sektiererische Spalter zu denunzieren. Offenbar hofft er, mit diesen servilen rhetorischen Übungen dem L/PDS-Apparat dabei zu helfen, seine bröckelnde Basis bei der Stange zu halten.
Fahnenflucht der rechten WASG-Führung
Die Mehrheit der Bundesführung der WASG demonstriert auf diese Weise, daß für sie das Projekt WASG inhaltlich und organisatorisch gestorben ist. Sie unterstützt neoliberale Landesregierungen und sie hat sich dafür entschieden, den rechtesten Elementen des PDS-Apparats die Drecksarbeit gegen die WASG-Linke zu machen. Sie weiß inzwischen, daß es sich als Teil dieses Apparats durchaus komfortabel leben läßt, wenn man sich die Linken erst einmal vom Hals geschafft hat.
Große Teile der WASG-Mitgliedschaft haben angesichts dieser Entwicklung mit den Füßen abgestimmt und die Partei verlassen. Viele haben sich offenbar gefragt, wozu sie sich in einer Partei engagieren sollen, deren Spitzenvertreter ihre eigenen proklamierten Ziele nicht ernst nehmen und die für ihre eigene Partei keine Zukunft sehen. Viele, nicht notwendig andere, werden sich gefragt haben, weshalb sie einer Partei beitreten sollen, die Politik gegen ihre Interessen betreibt. Ganz offenkundig übt die Perspektive des Beitritts zur vorgeblich neuen Linkspartei auf tausende von Mitgliedern keinerlei Anziehungskraft aus. Im Gegenteil. Die hölzerne Demagogie der PDS-Apparatschiks wird auch mit Hilfe Lafontaines nicht viele Hoffnungen mobilisieren.
Wie antwortet die WASG-Linke?
Der linke Flügel der WASG hat den schleichenden Massenaustritt aus der WASG nicht aufhalten können. Erstaunlicherweise werden seine Ursachen bisher auch von der Linken in der WASG kaum umfassend thematisiert. Stattdessen werden auch von Linken taktische Luftnummern aufgeführt, die kaum nachvollziehbar sind:
Das Netzwerk Linke Alternativen von Joachim Bischoff und Björn Radke und anderen kann mit seinen neokeynesianischen Konzepten bestenfalls als Beraterstab des künftigen Parteivorstands fungieren und darauf hoffen, Plätzchen in der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu erhaschen. Es handelt nach dem Motto, dabei sein ist alles.
Die schon parteiübergreifende "antikapitalistische Linke" mit Sarah Wagenknecht, Nele Hirsch und Thies Gleiss verfährt nach dem Prinzip Hoffnung auf bessere Zeiten und propagiert als loyale Opposition der Führung die Fusion. Angestrebt wird nach dem Modell der Kommunistischen Plattform der PDS offenbar die Funktion als linkes Feigenblatt des Apparats.
Die Linksruck-Führung wurde zum Opfer ihrer Illusion, daß die Fusion der WASG mit der Linkspartei/PDS unabhängig von der Entwicklung des Klassenkampfs bereits an sich einen Massenzustrom radikalisierter Massen in die fusionierte Partei bewirken würde. Sie glaubte deshalb, auf inhaltliche Auseinandersetzung und auf die Klärung strategischer und inhaltlicher Fragen verzichten zu können. Die angestrebte Fusion wurde deshalb zu ihrem Fetisch, dem sie im Bündnis mit prokapitalistischen Kräften ihre Seele opferte. Sie hat sich in Berlin als billiger politischer Jakob zum Büttel der Apparate gemacht und damit ins politische Abseits manövriert.
Was will die SAV?
Damit kommt der SAV als organisatorisch stärkster Kraft innerhalb der verbliebenen WASG-Linken eine Schlüsselstellung zu. Wie sieht sie die Lage?
Sascha Stanicic, Bundessprecher der SAV, diagnostiziert eine Abkehr der WASG vom Gründungskonsens, von einer prinzipiellen Absage an Sozialabbau und neoliberale Maßnahmen und der Ablehnung von Regierungsbeteiligungen, wenn damit kein "Politikwechsel in Richtung unserer Forderungen" verbunden ist. Er vergißt dabei zu sagen, daß die Formulierung "in Richtung" von vornherein einen prinzipiellen Gegensatz durch einen klassischen Formelkompromiß verdeckte. Dieser Gegensatz läßt sich, wie jetzt in Berlin sichtbar geworden ist, in der sozialen Realität nicht in einer Partei überbrücken. Sascha Stanicic hat recht, wenn er trotz verbaler Konzessionen der Parteirechten an die WASG-Linke eine Rechtsverschiebung der WASG feststellt. Seine und der SAV Antwort: Den Berliner Praxis-Test für die neue Linke abwarten. Dabei beruft er sich auf die Berliner WASG, die immer wieder erklärt hat, ihre Eigenkandidatur sei nicht gegen die Idee einer starken vereinigten Linken gerichtet.
Leider ist damit in keiner Weise für Klarheit gesorgt worden. Klarheit entsteht hier auch nicht durch Wiederholung. Für Vertreter des Konzepts einer rein parlamentarisch fixierten, reformistischen Perspektive richtet sich die Berliner WASG-Kandidatur selbstverständlich gegen eine starke vereinigte Linke. Für diejenigen, die die Stärke einer linken Partei daran messen, was sie zum Widerstand gegen die herrschende Politik beitragen kann, stellt die Eigenkandidatur der WASG gegen den Berliner Koalitionssenat potentiell einen Schritt dar zur Schaffung einer starken vereinigten Linken dar. Damit diesem Schritt weitere folgen können, müßte die Berliner WASG sich dezidiert dazu äußern, in welche Richtung sie gehen will. Das tut sie nicht und auch die SAV zögert und schweigt. Der Verzicht auf diese Kandidatur wäre ein Sieg des Neoliberalismus gewesen, eine kampflose Niederlage der WASG-Linken. Leider wird schon das nicht offen ausgesprochen. Der Verzicht auf die Formulierung weitergehender Perspektiven sowohl auf politischem wie organisatorischem Gebiet wird sich rächen.
Den Befürwortern des Fusionskurses wurden und werden immer noch inhaltliche Konzessionen gemacht. Anstatt unmißverständlich zu sagen, was zu sagen ist, nämlich, daß mit einer Linkspartei/PDS, die sich nicht klar, unzweideutig und öffentlich von der Politik ihrer Landesverbände in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern distanziert und deren Bundesführung die Lokalfürsten der betreffenden Landesverbände nicht energisch politisch bekämpft, eine Fusion ausgeschlossen sein muß, hüllt man sich in Ausflüchte. Wenn aus der fusionierten Partei eine Partei werden soll, die neoliberale Politik bekämpft, die gesellschaftliche Kräfteverhältnisse aktiv verändert, dann muß sich die Linkspartei/PDS vor einer Fusion bewegen. Nur so könnte unter Einschluß der Linkspartei/PDS eine starke vereinigte Linke entstehen. Stattdessen erleben wir immer wieder, daß Bewegung durch Roßtäuschertricks vorgegaukelt werden soll.
Damit hier keine Mißverständnisse entstehen: Eine starke Linke kann nur eine Partei sein, die mehr als eine Wahlpartei ist und ihren Schwerpunkt in der außerparlamentarischen Arbeit hat. Die Fusion mit dem PDS-Apparat und seinem fast schon entschlafenen, passiven Anhang kann nicht zur Entstehung einer solchen starken Linken beitragen. Daß die WASG-Linke keine Entschlossenheit im Kampf gegen die WASG-Rechte zeigt, beweist zugleich, daß auch die Linken in der WASG ihre bisherigen Konzepte überdenken müssen. Wenn sich die WASG auf Initiative ihres linken Flügels nicht deutlich verändert, besteht für die Linkspartei/PDS schon überhaupt kein Anlaß, auch nur oberflächliche Änderungen ihres Kurses ins Auge zu fassen.
Die L/PDS in Berlin kann es sich mit Hilfe von Lafontaine und Linksruck sogar erlauben, demonstrativ ihren Kurs zu bekräftigen. Ihr Apparat hat bereits jede Opposition ausgeschaltet. Die noch vorhandene Rentnerbasis befindet sich im Tiefschlaf. Es gibt nicht den geringsten Ansatz dafür, daß sie aufwacht. In den anderen Kernbastionen gilt dasselbe. Die Linkspartei/PDS hat sich nicht bewegt und wird sich auf absehbare Zeit nicht bewegen. Wenn sie sich überhaupt bewegt, dann weiter vorwärts auf ihrem Weg in die Arme der herrschenden Klasse. Sie bewegt sich schon gar nicht nach links. Keinen Millimeter!
Ihr Apparat behauptet also seine Position und hält an der bisherigen Politik nicht nur defensiv fest, sondern erklärt sie zum universell geltenden Modell. Das Ganze wird versteckt hinter Leerformeln wie der, daß die Partei ihre Identität bewahren muß. Im Klartext: Die Linkspartei/PDS und ihre Bündnispartner in der WASG wollen ein rein parlamentarisches Projekt. Sie werden, solange sie Opposition spielen (nichts anderes als spielen wollen ihre Chefstrategen), linke Töne von sich geben. Sie streben aber vorrangig in Regierungen, um dort in homöopathisch kleinen Dosen linke Reformpolitik zu verwirklichen. Deren Wirksamkeit ist sodann auch nur homöopathisch: real nicht nachweisbar, aber ihre Verwender glauben daran.
Sascha Stanicic hält dem entgegen, daß die künftige Partei nicht ausschließlich an der in ihr zum Zeitpunkt ihrer Gründung dominierenden Strömung zu messen ist. Maßgeblich sei die Frage, ob es ein Entwicklungspotenzial gibt. Das ist richtig. Aber ebenso richtig ist, daß es gegenwärtig keine verläßlichen Indikatoren dafür gibt, daß sich der Rhythmus der Klassenkämpfe in Deutschland auf absehbare Zeit dramatisch verändert bzw. so beschleunigt, daß wir mit breiteren Radikalisierungsprozessen und starken politischen Veränderungen rechnen müssen. Auch Sascha Stanicic rechnet damit nicht. Wenn das aber nicht zu erwarten ist, ist auch nicht mit dramatischen Veränderungen der Kräfteverhältnisse innerhalb der neuen Linkspartei zu rechnen. Die Linken, die dort ihr Glück versuchen wollen, begeben sich in die Geiselhaft des Apparats oder sie fliegen raus, wenn sie dessen Spielregeln nicht akzeptieren.
Sascha Stanicic beantwortet die selbstgestellte Frage nach dem Entwicklungspotential nicht. Stattdessen werden einander entgegengesetzte Hypothesen über die künftige Anziehungskraft der fusionierten Partei für Wähler und radikalisierte Aktivisten angerissen, um schließlich zur kryptischen These zu gelangen, daß der Kampf um die Ausrichtung und die politische Basis der neuen Partei "nicht vorzeitig" beendet werden sollte.
Das Problem des Zeitpunkts der Beendigung stellt sich doch den organisierten WASG-Linken jetzt noch gar nicht. Es stellt sich zum Zeitpunkt der Fusion, frühestens beim Parteitag, der darüber endgültig entscheidet. Die meisten WASG-Linken einschließlich der SAV müssen sich fragen lassen, weshalb sie den Kampf um die WASG nicht klarer und energischer führen, weshalb sie vor den Halbheiten Lafontaines und seiner Kapitulation vor dem L/PDS-Apparat in Ehrfurcht erstarren, weshalb sie nicht klipp und klar gegen diese von den Apparatschiks beider Seiten angestrebte Fusion ankämpfen, die nur um den Preis des Verzichts auf ein reales sozialistisches Parteiprojekt zu haben ist.
Wer hierzu klare Worte erwartet, wird von Sascha Stanicic enttäuscht. Es folgt bei ihm die banale Feststellung, daß der Ausgang der Wahl zum Abgeordnetenhaus einen wichtigen Einfluß auf die weiteren Debatten haben wird. Ein Sprung ins Parlament würde die Aussichten für die Linke verbessern, aber dennoch keine Veränderung der Mehrheitsverhältnisse in der WASG herbeiführen können.
Faktisch wird der Kampf gegen diese (!) Fusion damit schon aufgegeben, bevor er überhaupt zu Ende geführt wurde. Das bedeutet aber auch, daß auf die inhaltliche Zuspitzung des Kampfes, die notwendig ist, um allen Mitgliedern und Anhängern der WASG klar zu machen, worum es geht, verzichtet wird. Damit wird faktisch die Methode der Klaus Ernst und Co. geadelt, grundlegende Entscheidungen ohne vorherige gründliche Debatten zu treffen: Deren Kalkül, damit letztendlich doch ungeschoren durchzukommen, geht auf.
Ein strategischer Offenbarungseid
Sascha Stanicic setzt alles auf die Berliner Karte:
Die WASG-Linke, so meint er, hätte bei einem Wahlerfolg in Berlin in der fusionierten Partei einerseits verbesserte Perspektiven für den Aufbau einer Opposition, andererseits seien die Gräben in Berlin wohl doch nicht zu überbrücken. Was die SAV wirklich will, wird nicht gesagt. Das Netzwerk Linke Opposotion solle diesen Kampf in der neuen Linkspartei führen und zugleich offen bleiben für Kräfte außerhalb der fusionierten Linkspartei. Es sei aber ein Fehler, in den nächsten Monaten und Jahren eine weitere, sechste Partei auszurufen. Eine solche Partei sei in den nächsten Monaten und Jahren zum Scheitern verurteilt und könne zumindest außerhalb Berlins keinen Masseneinfluß gewinnen.
Das alles ist ein strategischer Offenbarungseid. Der Versuch, eine sozialistische und das kann nur heißen marxistische Partei aufzubauen, ist und bleibt jederzeit richtig.
Wenn es 2003, 2004 und 2005 richtig war, neben SPD und PDS eine neue linke Partei aufzubauen, wenn es ein Bedürfnis für eine neue sozialistische Arbeiterpartei gab, dann ist nicht nachvollziehbar, weshalb ein solches Projekt im Herbst 2006 plötzlich falsch sein sollte. Eine andere Frage wäre, ob das bei der Gründung der WASG verfolgte Bündniskonzept richtig war. Aber diese (zu verneinende) Frage stellt und beantwortet Sascha Stanicic nicht. Wenn jedoch von einem Bedürfnis der Klasse der Lohnabhängigen nach einer marxistischen Partei ausgegangen wird, so ist dieses eher größer geworden. Die Frage, ob die marxistische Linke stark genug ist, kurzfristig mit Fraktionen in die Parlamente zu ziehen, kann nicht die alles entscheidende sein.
Das Netzwerk Linke Opposition in Nordrhein-Westfalen hat jetzt in einem Thesenpapier beschlossen, eine Beteiligung an der Fusion von inhaltlichen Bedingungen abhängig zu machen: Neugründung der Partei statt Beitritt der WASG zur Linkspartei/PDS, Trennung von (Partei-)Amt und (Parlaments-)Mandat, Ausschluß von Privatisierungen, keine Beteiligung an Regierungen, die Sozialabbau und Tarifflucht betreiben, keine Akzeptanz von Bundeswehreinsätzen im Ausland). Das geht in die richtige Richtung. Was leider noch fehlt, ist die Bereitschaft, gegen die WASG-Führung energisch in die politischen Offensive zu gehen. Die Linken in der WASG müssen die Abwahl der Bundesführung fordern, die nichts tut, um die politischen Grundsätze der WASG in den Fusionsprozeß einzubringen. Die Entscheidung, vor der die WASG-Mitglieder stehen, lautet in erster Linie nicht Fusion oder Nicht-Fusion, sondern in der politischen Wirklichkeit Kampf gegen den Neoliberalismus oder Beteiligung an neoliberaler Politik. Sie lautet Aufbau einer antikapitalistischen Kraft oder Arzt am Krankenbett des unheilbar chronisch erkrankten Kapitalismus. Die Neokeynesianer bieten nur eine Scheinalternarive zur neoliberalen kapitalistischen Politik. Immer, wenn es praktisch wird, kapitulieren sie vor dem Neoliberalismus. Mit der jetzigen WASG-Führung kann es daher gar keinen modus vivendi geben. Niemand kann ernsthaft annehmen, daß die WASG diese beiden Lager auch künftig vereinen kann. Die WASG-Führung ist entschlossen der Linkspartei/PDS beizutreten. Es geht also nur um die Frage, ob und in welcher Form die WASG überlebt oder nicht.
Will die WASG-Linke die WASG als Alternative erhalten, wird auch sie Kurskorrekturen vornehmen müssen.
Aussichten eines Alternativprojekts
Wenn die neue, fusionierte Partei unter Gysi und Lafonataine in eine Mittel-Links-Regierung eintritt, könnte sich eine Alternative dazu prächtig entwickeln. Würde die Linkspartei im Bund in der Opposition bleiben und sich weiterhin nur in den Ländern und Kommunen die Hände in den kapitalistischen Niederungen schmutzig machen, bliebe die Lage aller Wahrscheinlichkeit ähnlich wie heute - grundlegende Stabilität im Hinblick auf die Klassenverhältnisse im übrigen vorausgesetzt. Aber wenn auch langsam, so ist doch festzustellen, daß die Grundlagen der gesellschaftlichen Stabilität durch den Klassenkampf von oben systematisch untergraben werden. Es gibt also keinen Grund, in Pessimismus zu verfallen, zumal gegen die herrschende Politik immer mehr und immer häufiger Widerstand aufflammt.
Ein neues Parteiprojekt würde vielleicht nicht unbedingt sofort mit großartigen Erfolgen aufwarten können. Das spricht aber nicht gegen den Versuch, es in Angriff zu nehmen. Dieser Versuch sollte aber die Lehren aus den Problemen ziehen, die die WASG-Gründung aufgeworfen hat.
Es sprechen zunächst einige Gründe dafür, sich von wichtigen Illusionen der vergangenen Jahre zu verabschieden:
1. Eine neue sozialistische Partei kann keine Sammlungsbewegung im Sinne bloßen Addition von Unzufriedenen aus allen politischen Lagern sein. Sie braucht über die Ablehnung neoliberaler Politik hinaus eine klare antikapitalistische Konzeption.
2. Die Alternative zum Neoliberalismus ist nicht Neokeynesianismus sondern Sozialismus. Beide Perspektiven sind miteinander nicht vereinbar.
3. Über die grundlegenden Ziele, strategischen und taktischen Optionen (außerparlamentarische Arbeit, Bündnispolitik, Wahlbeteiligungen, Parlamentsarbeit, Beteiligungen an Regierungen ja oder nein) sollte bei einer Gründung Klarheit herrschen. Der Gründung müßte sowohl eine gründliche Debatte als auch eine Phase gemeinsamer praktischer Arbeit vorausgehen.
4. Sammlungsbewegungen sind nicht notwendig demokratisch. Eine neue sozialistische Partei darf nicht wie die WASG zum Manövrierfeld und Beuteobjekt reformistischer Apparatschiks werden. Sie braucht von Anfang an Transparenz und demokratische Strukturen. Nicht die dauernde Koexistenz von verschiedenen Strömungen ist ein Zeichen für Parteidemokratie, sondern ein lebendiger Diskussionsprozeß zur Klärung und Weiterentwicklung ihrer Positionen.
5. Das Verhältnis einer neuen Partei zu den bestehenden Parteien und Bewegungen sollte vorrangig geklärt werden. Ohne Klarheit auf diesem Gebiet wird eine neue Partei nicht vereint bestehen können.
Dieter Elken (Marxistische Initiative)
www. marxismus-online.eu